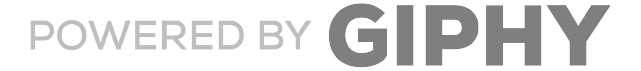Filmton
Ton im Film
Inhaltsverzeichnis
Vom Filmton zum Tonfilm
Für eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Ton im Kino muss zunächst zwischen der technisch-historischen und der künstlerischen Konstitution des Filmtons unterscheiden werden. Erster Aspekt betrifft die Struktur des Kino-Dispositivs als audiovisuellem Apparat, zweiter den kreativen Gestaltungsraum im Zusammenspiel von Bild- und Tonebene. Ton war bereits im frühen Kino ein integraler Bestandteil der filmischen Aufführungspraxis, auch wenn die ersten dreißig Jahre der Kinogeschichte bis heute gemeinhin als Stummfilm bezeichnet werden. Das bürgerliche Publikum, das die junge Kunstform, nachdem diese ihre Anfänge als Jahrmarktattraktion gerade hinter sich gelassen hatte und in die glamourösen Kinopaläste abgewandert war, noch in der Theatertradition verortete, betrachtete die musikalische Begleitung eines Films als Selbstverständlichkeit. Die klangliche Dimension des Kino-Apparats geriet erst durch die Verbreitung elektrischer Abspielsysteme in den 1920er-Jahren in den Fokus von Kulturkritikern und Filmpuristen. Plötzlich war es Filmemachern technisch möglich, Dialoge und Filmmusik mit dem Bild synchronisieren.
Die amerikanische Firma Vitaphone brachte die frühen Experimente mit einem synchronen Filmton über ein sogenanntes Sound-on-Disc-System, in dem der Ton von einer Schallplatte zugespielt wurde, erstmals zur kommerziellen Anwendung. In „The Jazz Singer“ (R: Alan Crosland, USA 1927) ertönte die Stimme Al Jolsons lippensynchron zu den Gesangsnummern auf der Leinwand: Der Sänger wurde über Nacht zum Filmstar. Durch die Einführung des Synchrontons entstand auch erstmals ein filmtheoretischer Diskurs über das Verhältnis von Bild und Ton im Kino. Im frühen Film war (Live-)Musik primär zur Akzentuierung der Dramatik, als komödiantisches Element oder als eigenständige künstlerische Darbietung zum Einsatz gekommen. Dieses änderte sich mit der Einführung des Filmtons grundlegend. Der synchrone Ton erhob – im Gegensatz zum gestenreichen, abstrakten Spiel der Darsteller*innen – erstmals den Anspruch auf Realismus und veränderte damit auch die Rezeption des Kinos als künstlerisches Medium.
Realismus, Kontrapunkt, Dramaturgie
Insbesondere in England herrschte lange Skepsis gegenüber der technischen Errungenschaft. Noch 1930 sprach der britische Filmpionier Paul Rotha in seinem Buch „The Film Till Now“ der Synchronisation von Bild und Ton künstlerische Berechtigung ab: „It is a degenerate and misguided attempt to destroy the real use of the film and cannot be accepted as coming within the true boundaries of the cinema.“[1]Mit seinem Urteil stand Rotha nicht allein da. Zwei Jahre zuvor hatte der englische Autor Ernest Betts in seinem Buch „Heraclitus, or the Future of Films“ geschrieben, dass der Tonfilm die Seele des Kinos zerstören würde. („The soul of the film - its eloquent and vital silence - is destroyed.“[2]) Realismus war in den transitorischen Jahren vom sogenannten Stumm- zum Tonfilm der Schlüsselbegriff im Diskurs um den Ton im Kino. Es erforderte eine junge Generation von Regisseuren wie Alfred Hitchcock in England und Fritz Lang in Deutschland, um den Klang im Kino als Erweiterung des künstlerischen Ausdrucks zu begreifen.
Der Diskurs über den Realismus des Filmtons sollte Kritiker, Theoretiker und Filmschaffende noch Jahrzehnte beschäftigen. 1928 begrüßten Sergej Eisenstein, Wsewolod Pudowkin und Grigori Alexandrow in ihrem „Manifest zum Tonfilm“ den technischen Durchbruch zwar, sie proklamierten jedoch im Sinne von Eisensteins Montage-Theorie eine „kontrapunktische Verwendung“ des Filmtons, um die Entwicklung der in ihrem Wesen revolutionäre Kunstform nicht zu beeinträchtigen. Eisenstein, Pudowkin und Alexandrow schwebte, wie sie schrieben, keine „Illusion sprechender Menschen“ vor. Jean-Luc Godard sollte diesen politischen Ansatz der Bild/Ton-Asynchronität in seinen Arbeiten der 1960er-Jahre, insbesondere der Satire „Weekend“, wieder aufgreifen. Realismus wurde speziell in der europäischen Filmtheorie skeptisch betrachtet. Noch in den 1970er-Jahren schrieben Christian Metz und [1]Jean-Louis Baudry dem Ton eine rein technische Funktion zu, weil er einen vermeintlichen realistischen Eindruck vermittelte – während dem Spiel der DarstellerInnen immer eine künstlerische Qualität zugesprochen wurde.
Fritz Lang gehörte zu den ersten Regisseuren, die den Klang im Film auch dramaturgisch begriffen. In „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ (Deutschland 1931) kündigte das Pfeifen des Kindermörders eine Bedrohung an, noch bevor sein Schatten im Bild zu sehen war. Langs Film war damit auch ein frühes Beispiel für die diegetische Verwendung von Musik: Die Melodie des Mörders, sein musikalisches Motiv, gehörte zur Filmhandlung und unterschied sich damit vom orchestralen Soundtrack, der eine äußerlich dramatische Funktion übernahm. Dieser Kniff stellte seinerzeit für viele ZuschauerInnen noch eine Herausforderung an ihre "Medienkompetenz" dar. In den Anfängen des frühen Tonfilms war es keineswegs selbstverständlich, dass das Publikum ein Geräusch, dessen Quelle nicht erkennbar war, zuordnen konnte. Solche Transferleistungen bestimmten die ersten Jahre des Tonfilms, zumal der frühe Lichtton, der inzwischen als optische Tonspur neben dem Bildkader auf dem Filmstreifen mitlief (Sound-on-Film-Verfahren), für das menschliche Ohr noch sehr blechern klang.
Auf diesen Mangel an klanglichem Naturalismus reagierte Alfred Hitchcock 1963 mit „Die Vögel“ (The Birds, USA 1963), indem er bewies, dass die Vorstellung eines realistischen Filmtons überholt war. Weil ihm echte Vogelgeräusche nicht naturalistisch und damit bedrohlich genug klangen, suchte er nach einer Möglichkeit, das aggressive Gekreische der Vögel zu stilisieren, um einen stärkeren psychologischen Effekt zu erzielen. Dabei stieß er auf den Berliner Komponisten Oskar Sala, der Anfang der 1950er-Jahre das Mixturtrautonium entwickelt hatte: eine Art frühen Synthesizer mit einem völlig neuen Klangspektrum. Hierauf entstand das berühmte Vogelgeschrei, der längst ein Signaturgeräusch des modernen (Horror-)Films ist.
Geräuschemacher und Sounddesigner
Aus dem Umstand, dass der Mensch Geräusche im Kino anders wahrnimmt als im Alltag, entstand innerhalb der Filmindustrie früh ein eigener Berufszweig, der sogenannte Foley Artist (benannt nach dem legendären Geräuschproduzenten der Universal Studios, Jack Foley). Der Foley Artist schöpft aus einem Archiv von Klangquellen, um die Eigenschaften eines Geräusches zu imitieren und damit einen „authentischen“ Eindruck zu erzeugen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Arbeit von Ben Burtt am ersten „Star Wars“-Film von 1977, für den er – ohne den Einsatz von Synthesizern – eine völlig neue Klangwelt schuf. Der Klang der Zukunft entstand aus Alltagsgeräuschen der Gegenwart: das Gefechtsfeuer emulierte Burtt mit gespannten Metallspiralen, das Summen der Laserschwerter mit den Betriebsgeräuschen alter Fernseher und die Sprache der Wookie bestand aus modulierten Aufnahmen von Walrössern. Der Foley Artist muss demnach über viel Fantasie und ein großes Repertoire an Klangerzeugern verfügen, um die Komplexität unserer Geräuschwelt nachzuempfinden.
Burtt verdiente sich als erster Klangtüftler die Bezeichnung Sound Designer, die etwa Mitte der 1970er-Jahre aufkam. Die künstlerische Sozialisation von jungen New-Hollywood-Regisseuren wie George Lucas, Steven Spielberg oder Francis Ford Coppola war maßgeblich über die Popkultur der 1960er-Jahre erfolgt. Daher zeigten sie ein verstärktes Interesse an der Technologie der Musikindustrie, die der Tontechnik im Film um ein paar Jahre voraus war. Die Ankunft moderner, computerisierter Mischpulte in den 1970er-Jahren vereinfachte die Arbeit der neuen Sound Designer schlagartig. Burtt wurde zum Prototyp des Studioproduzenten im Sinne eines Tony Visconti (verantwortlich für die klassischen David Bowie-Alben) oder eines George Martin, dem Produzenten der Beatles. In der Person Burtts vereinten sich erstmals alle künstlerischen Aufgaben der Klangproduktion, von der Aufnahme, über den Schnitt bis zur finalen Abmischung.
Technologische Entwicklungen - Dolby und THX
Schon immer war die Entwicklung des Filmtons auch technologisch bedingt. Dolby Stereo löste im Jahr 1976 endgültig den Monoton ab, kurz darauf wurden die ersten komplexen Surround-Systeme eingeführt, mit denen ein räumliches Hörerlebnis simuliert werden konnte. Walter Murch setzte den Mehrkanalton erstmals kreativ ein. Für Francis Ford Coppolas „Apocalypse Now“ (USA 1979) arbeitete er mit einer dem späteren Dolby 5.1 vergleichbaren Tonspur: Die sechs Kanäle (zwei Lautsprecher vorne, zwei hinten, einer in der Mitte plus ein sechster Subwoofer für die tiefen Töne) erzeugten eine für die damalige Zeit ungehörte Klangdynamik. Murch und Coppola wollten den Krieg physisch und psychisch spürbar machen: Kino als subjektive Erfahrung. Das hypnotische Rattern der Rotorblätter, das von allen Seiten auf das Publikum einwirkte, wurde zum Markenzeichen des US-amerikanischen Kriegsfilms. Wie sehr Coppola der Filmsound am Herzen lag, bewies er Jahre später mit der Einführung des THX-Standards, der Richtlinien für die Klang- und Bildqualität in den Kinos, in denen seine Filme liefen, festlegte.
Herausragende Beispiele
Zu den schönsten Beispielen für den künstlerischen Umgang mit Geräuschen und Klängen gehören bis heute die Filme Jacques Tatis. In „Play Time“ (Frankreich, Italien 1967) sind die Dialoge meist nur als Gesprächsfetzen oder Gemurmel im Hintergrund zu hören. Dafür schuf Tati, der einzige Stummfilmstar des Tonfilms, eine reiche Geräuschkulisse, in der noch der nebensächlichste Gegenstand über ein akustisches Eigenleben verfügt. Die Tonspur erzählt mit ihren absurden akustischen Spielereien eine eigene Geschichte.
Aber auch experimentelle Filmemacher entdeckten in ihrer Beschäftigung mit der Materialität des Films den Ton für sich. Die Österreicher Peter Kubelka arbeitet in „Arnulf Rainer“ (1960), einem Klassiker des Avantgardefilms, mit weißem Rauschen und absoluter Stille, um die Metrik des Kino-Apparats, der seit der Einführung des optischen Lichttons auf einer Frequenz von 24 Bildern pro Sekunde basierte, visuell und akustisch zu übersetzen. Auf einer ähnlichen Idee, der Arbeit mit dem Filmmaterial selbst, beruht Peter Tscherkasskys „Outer Space“ (1999). Hier tritt das buchstäblich Äußere des Filmbildes, das in der Aufführung vom Projektionsapparat maskiert wird, in das Bild zurück. Der optische Lichttonstreifen greift auf die Bildkader zu und erzeugt durch die „unsachgemäße“ Behandlung des Projektors einen infernalischen Lärm. Die Stille, mit der Kubelka und Tscherkassky in ihren Filmen arbeiteten, ist ein Phänomen, das paradoxerweise erst mit dem Tonfilm aufkam.
Robert Bresson schrieb in seinen berühmten „Notes on Cinematography“, dass der Soundtrack die Stille erfunden habe.[3] Im Kino muss aber auch diese Stille über einen spezifischen Klang, eine Atmosphäre, verfügen.
Kelly Reichardt hat in ihrem feministischen Spätwestern „Meek's Cutoff“ (USA 2010) eine überzeugende Lösung für dieses Problem gefunden. Ihr Film erzählt die Geschichte eines Trecks durch die verlassenen Geröllwüsten Oregons. Doch statt die Tonspur "tot" zu belassen, hat Reichardt den umgekehrten Ansatz gewählt. Sie füllt den Klangraum mit Geräuschen, aufgenommen von Umgebungsmikrofonen, die den reinen Umweltgeräuschen ein atmosphärisches Grundrauschen hinzufügen. Das Ergebnis ist eine klanglich reiche Tonspur, ohne dass konkrete Geräusche zu hören sind.
Digitalisierung, Science Fiction
Ganz andere Möglichkeiten, um dem Klang der Stille zur Geltung zu bringen, ergeben sich in der digitalen Postproduktion des modernen Blockbusterkinos. Eine der entscheidenden Fragen des Science-Fiction-Kinos, die auch schon Stanley Kubrick mit „2001“ beschäftigte (Wie klingt der Weltraum?), löst Regisseur Alfonso Cuarón in „Gravity“ mithilfe eines sinfonischen Scores, der einerseits als extra-diegetischer[2]Soundtrack und gleichzeitig als „Nachvertonung“ der lautlosen Action-Sequenzen fungiert. Cuarón und sein Komponist Steven Price füllen die klangliche Leere des Space mit dramatischer Polyphonie. Technisch eindrucksvoller ist das akustische Oxymoron der „dröhnenden Stille“ im Kino bisher nicht umgesetzt worden.
Weiterführende Links
Paul Rotha. The Film Till Now
https://archive.org/details/filmtillnow00roth
Manifest zum Tonfilm
http://www.mediaartnet.org/quellentext/90/
"The Sound of Apocalypse Now"
https://soundandinteraction.wordpress.com/2011/10/10/the-sound-of-%E2%80%9Capocalypse-now%E2%80%9D/
Robert Bresson. Notes on Cinematography
http://projectlamar.com/media/notes_on_cinematography.pdf