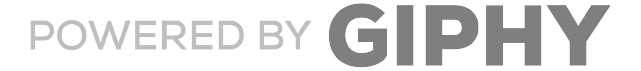Aktivistische Filmkritik
Ansatz
Kritiken nehmen Filme in den Blick, versuchen sie zu erfassen und zu vermitteln. Dafür gehen Autorinnen und Autoren von einer Beobachterposition aus, stellen sich vor oder glauben daran, dass sie Unbeteiligte sind, weil sie unabhängig sind. Unabhängig vom wirtschaftlichen Interesse am Erfolg des Films, unabhängig von den Produktions- und Verwertungszusammenhängen. Filmkritik ist daher eine Position, die tatsächlich am Rand entsteht, in einem imaginierten Außen. Was nicht ausschließt, dass es Rückkopplungseffekte geben kann auf die Produktion. Ohnehin nimmt Kritik natürlich Einfluss auf die Wahrnehmung, vor allem darauf, welche historische Bedeutung Filme entfalten.
Die Betonung des „Außen“ bietet einen Komfort, auch einen echten Schutz davor, hineingezogen zu werden in Fragen, die die eigene Wirkung betreffen. Es ist vornehmer, sich davon nicht allzu sehr behelligen zu lassen. Es ist eine bequeme Position, sich für gute, fordernde, aufregende Filme einzusetzen, ohne daran gemessen werden zu müssen, ob das auch klappt. Kritiken werden schließlich an anderen Dingen gemessen: an Klickzahlen, an ihrer Verbreitung, an ihrem eigenen Unterhaltungswert, am Renommee, das sie bringen.
Die Legitimität der Kritikerin und des Kritikers geht damit einher, dass ihre subjektive Betrachtung des Gegenstands nicht käuflich ist. (Wenn das nur immer stimmen würde.) Sie muss aber nicht damit einhergehen, dass sich Kritiker raushalten, wenn es dreckig wird. Aktivistische Filmkritik sagt der eigenen Zurückhaltung den Kampf an, lässt den Glauben hinter sich, unbeteiligt zu sein, und bewegt sich aufs Terrain. Das heißt zum einen, den geschützten Rahmen der Berichterstattung zu verlassen und selbst zu gestalten, zum Beispiel die Woche der Kritik, die parallel zur Berlinale Positionen der Kinokultur hinterfragt. Zum anderen heißt es, eine falsche Vorstellung von Distanz aufzugeben, wo sie ohnehin nur vorgegaukelt ist, sich einzumischen, Akteur von Debatten zu sein. Statt die eigene Position zu verschleiern, wird sie transparent gemacht. Filmkritik wird dadurch ehrlicher und eigensinniger.
Aktivistische Filmkritik will etwas verändern, sie versteht sich als politisch. Sie ergreift Partei für die fordernde, lebendige, anregende Kinokultur. Ausgerufen wurde sie 2014 in einem bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen verteilten Flugblatt vom Vorstand des Verbands der deutschen Filmkritik als Reaktion auf die zunehmend trostlose Situation der deutschen Kinolandschaft. Besonders sorgte uns, dass sich viele Programmkinos austauschbaren Filmen unter dem Label „Arthouse“ verschreiben und darüber die tatsächliche Programmarbeit ins Hintertreffen gerät. Es ist ein Symptom für weitreichende Veränderungen. Neben der Abhängigkeit von primär kommerziellen Erwägungen sind viele Tätigkeiten im Film- und Kinosektor zugleich stärker abhängig von der Politik geworden – und haben sich dadurch de facto entpolitisiert. Positionen, die sich für Filmkultur einsetzen und dies lebensweltlich füllen können, zum Beispiel aus der Praxis als Kinobetreiber, als Produzentin oder Festivalkurator, sind leiser geworden. Gibt es neben Lars Henrik Gass[1] (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen - Anm. der Red.) noch einen Festivalleiter in Deutschland, der es wagen würde, sich öffentlich mit der Filmpolitik anzulegen? Die Arbeitszusammenhänge sind prekär oder werden als solche empfunden. Gerade Festivals, die eine besonders wichtige Rolle eingenommen haben, sind davon betroffen: Chefinnen und Chefs haben Angst, werden politisch eingesetzt und vereinnahmt. Sie begeben sich in den Teufelskreis einer zunehmend schwachen oder schwammigen eigenen Haltung und werden just dadurch immer austauschbarer, wodurch ihre Abhängigkeit und der Druck zur politischen Zurückhaltung noch weiter wächst. Filmkritik darf darauf nicht routiniert oder abgeklärt reagieren. Sie darf sich nicht auf die pure Dienstleistung einzelner Besprechungen zurückziehen. Sie muss die Zusammenhänge immer wieder in den Blick nehmen, denn sie sind nicht unveränderlich.
Woche der Kritik
Eine Woche aktivistische Filmkritik in Berlin, seit 2015. Die Woche der Kritik ist eine Film- und Debattenreihe, initiiert von den Verfassern des Flugblatts für aktivistische Filmkritik, getragen vom Verband der deutschen Filmkritik mit Partnern wie der Heinrich-Böll-Stiftung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Mit ihrem parallel zur Berlinale stattfindenden Programm versteht sich die Woche der Kritik als ein Gegenüber der großen Festivalmaschinerie, das sich einer kritischen Befragung der heutigen Kinokultur verschreibt. Die Mechanismen, die von der Finanzierung über die Produktion, den Vertrieb und das Abspiel bis hin zur Rezeption greifen, sollen dabei in den Blick genommen werden. Es geht also gleichzeitig um das einzelne Werk – lediglich sieben Filmprogramme werden gezeigt – als auch um das große Ganze. Die Woche der Kritik ist ein Versuchslabor für eine kritische Intervention, die sich selbst der Kritik stellen will. Sie schafft daher nicht nur einen diskursiven Raum, sondern braucht den tatsächlichen, physischen Ort, an dem ihre Anliegen als Gegenstände sichtbar sind und leibhaftig vertreten werden. In all ihrer Vorläufigkeit und Fragilität soll die Intervention so selbst greifbar sein.